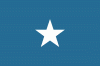 Trotz widriger Umstände findet die kirchliche Hilfsarbeit ihren Weg nach Somalia. Das berichtet Giorgio Bertin, Bischof von Dschibuti und Apostolischer Administrator von Mogadischu, im Gespräch mit Radio Vatikan. Gerade weil die politische Lage in dem Land am Horn von Afrika so unsicher ist, hat die Jahrhundertdürre dort besonders verheerende Folgen: Zu Hunger und Armut kommen Unruhen und Gewalt, was viele Menschen in die Flucht treibt. Und während Hilfsorganisationen in den Nachbarländern Äthiopien und Kenia vor Ort das Schlimmste zu verhindern suchen, wäre ihr Einsatz in Somalia tödlich. Dazu Bischof Bertin:
Trotz widriger Umstände findet die kirchliche Hilfsarbeit ihren Weg nach Somalia. Das berichtet Giorgio Bertin, Bischof von Dschibuti und Apostolischer Administrator von Mogadischu, im Gespräch mit Radio Vatikan. Gerade weil die politische Lage in dem Land am Horn von Afrika so unsicher ist, hat die Jahrhundertdürre dort besonders verheerende Folgen: Zu Hunger und Armut kommen Unruhen und Gewalt, was viele Menschen in die Flucht treibt. Und während Hilfsorganisationen in den Nachbarländern Äthiopien und Kenia vor Ort das Schlimmste zu verhindern suchen, wäre ihr Einsatz in Somalia tödlich. Dazu Bischof Bertin:
„In Somalia können wir leider nicht so direkt arbeiten wie in Äthiopien oder Dschibuti. Denn die am meisten betroffene Region ist Zentral- und Südsomalia. Und da gibt es keinen Staat. Wenn wir dort physisch arbeiten, gehen wir große Risiken ein, getötet oder entführt zu werden. Deshalb helfen wir durch lokale somalische Partner. Das sind Muslime, mit denen wir seit 20, 30 Jahren Kontakte pflegen und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Normalerweise präsentieren sie eine Art Projekt, wir prüfen das, senden ihnen das Geld und sie kaufen vor Ort die wichtigsten Dinge: Essen und derzeit vor allem Plastikplanen, denn in den letzten Monaten gab es viel Regen hier."
Zum Hunger als Folge der Dürre kämen seit etwa drei Monaten starke Regenfälle hinzu, berichtet der Bischof weiter. Diese setzten auch den zahlreichen Flüchtlingen zu, die nach Kenia und Äthiopien geflohen sind. In einigen Regionen kann der Regen zwar Erleichterung bringen, der Hunger kann damit aber nicht so schnell beendet werden. Denn nur unter besseren Sicherheitsbedingungen kann wieder richtig Landwirtschaft betrieben werden:
„Wir sehen in Somalia die perversen Effekte der Abwesenheit des Staates. Die Situation betrifft das gesamte Horn von Afrika, aber sie ist besonders dramatisch in Zentral- und Südsomalia, denn es kommen die Kämpfe hinzu, die in den letzten 20 Jahren in Somalia zwischen verschiedenen Gruppen an der Tagesordnung sind."
Dass den Menschen in Somalia erst langfristig geholfen werden kann, wenn die Sicherheitslage dort stabiler ist – darüber sind sich Kirchenvertreter, Hilfsorganisationen und westliche Politiker einig. Die Bundesrepublik Deutschland machte ihre Entwicklungszuschüsse für das Land in den vergangenen Jahren von der politischen Stabilität des Landes abhängig. Wegen der aktuellen verheerenden Notsituation hat der deutsche Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, in diesen Tagen diese eingefrorenen Geldmittel für Somalia freigegeben. Niebel äußerte sich zur Frage in Berlin bei einem Treffen mit einem Vertreter der somalischen Übergangsregierung, Vizepremier Ibrahim. Die zehn Millionen Euro sollen unter anderem zum Erhalt und zur Wiederaufstockung von Viehbeständen verwendet werden.
Für Bischof Bertin heißt langfristige Hilfe auch Vorbeugung weiterer Dürre- und Hungerkatastrophen. So hat er großes Interesse daran, den Ursachen der Krise auf den Grund zu gehen:
„Catholic Relieve Services hatte ein Team geschickt, um sich das Dürreproblem näher anzusehen und eine Studie durchzuführen. Ich habe sie nach Dschibuti eingeladen und gebeten, bei uns eine ähnliche Untersuchung zu machen. Denn es gibt da ähnliche Erfahrungen: Die Dürre hat hier wie dort Bauern und Nomaden zugesetzt, die mit Kamelen, Ziegen und Kühen in der Landschaft leben. Die brauchen Regen und Wasser. Obwohl Dschibuti nicht hauptsächlich von Viehwirtschaft lebt, sondern von Handel, leben dennoch immerhin ein Fünftel der Bevölkerung so." (rv)

