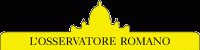Ein Interview des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat aufhorchen lassen. In einem Zitat, das am Mittwoch daraus bekannt wurde, würdigt Benedikt seinen Nachfolger Franziskus dafür, dass er die göttliche Barmherzigkeit zu einem Leitthema seines Pontifikats gemacht hat. Es ist die erste „öffentliche“ Äußerung des emeritierten über den amtierenden Papst.
Ein Interview des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat aufhorchen lassen. In einem Zitat, das am Mittwoch daraus bekannt wurde, würdigt Benedikt seinen Nachfolger Franziskus dafür, dass er die göttliche Barmherzigkeit zu einem Leitthema seines Pontifikats gemacht hat. Es ist die erste „öffentliche“ Äußerung des emeritierten über den amtierenden Papst.
An diesem Donnerstag hat die Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ auf einer Doppelseite den gesamten Text des Interviews auf Italienisch veröffentlicht. Daraus wird deutlich, dass der Akzent des vom Jesuiten Jacques Servais geführten Interviews vor allem auf dem Thema der Rechtfertigung des Menschen vor Gott liegt – einem Thema, das vor fünfhundert Jahren zum Anstoß der Reformation durch Martin Luther wurde.
Papst Benedikt äußert sich zunächst zum kirchlichen Charakter des Glaubens. „Einerseits ist der Glaube ein zutiefst persönlicher Kontakt zu Gott, der mich im Innersten anrührt und mich in völliger Unmittelbarkeit vor den lebendigen Gott stellt“, so Benedikt. Doch gleichzeitig habe „diese zutiefst persönliche Realität untrennbar mit Gemeinschaft zu tun“. „Es gehört zur Essenz des Glaubens, mich einzuschreiben ins Wir der Kinder Gottes, in die pilgernde Gemeinschaft der Brüder und Schwestern.“ Glauben löse aus der Isolation und füge den Glaubenden in die Gemeinschaft der Kirche ein.
Die Kirche wiederum habe sich „nicht selbst geschaffen“, sondern werde „fortwährend von Gott gebildet“; sie produziere nicht sich selbst, sondern solle zur Begegnung mit Christus führen; man trete in sie „nicht durch einen bürokratischen Akt“ ein, sondern durch das Taufsakrament. „Eine Seelsorge, die die geistliche Erfahrung der Gläubigen anleiten will, muss von diesen Grundgegebenheiten ausgehen“, so Benedikt XVI.
„Als ob Gott sich rechtfertigen müsse, nicht der Mensch“
An diesem Punkt bringt der Interviewer die Rechtfertigungslehre ins Spiel. Luthers Erfahrung sei von der „Angst vor dem Zorn Gottes“ geprägt gewesen; dieses Gefühl sei „dem modernen Menschen eher fremd“. Wie könne die Rechtfertigungslehre des Paulus denn den Menschen von heute überhaupt noch erreichen? Das greift der emeritierte Papst auf: „Für den Menschen von heute haben sich die Dinge im Vergleich zur Zeit Luthers und zur klassischen Perspektive des christlichen Glaubens gewissermaßen umgekehrt. Es ist gar nicht mehr der Mensch, der glaubt, die Rechtfertigung vor dem Angesicht Gottes nötig zu haben; vielmehr ist er der Ansicht, es sei Gott, der sich für alle furchtbaren Dinge, die es auf der Welt gibt, und angesichts des Elends des Menschen rechtfertigen müsste – alles Dinge, die letztlich ja von ihm (Gott) abhängen.“
Benedikt XVI. weist darauf hin, dass ein (ungenannter) katholischer Theologe den Kreuzestod Jesu so deute, als sei Christus „nicht für die Sünden der Menschen gestorben, sondern um sozusagen die Schuld Gottes zu sühnen“. Das sei zwar „eine drastische Umkehrung unseres Glaubens“, die sicher von den meisten Christen nicht geteilt werde, doch lasse sie „eine Grundtendenz unserer Zeit hervorscheinen“. Johann Baptist Metz habe mit seiner Forderung, die heutige Theologie solle „theodizeeempfindlich“ sein, „dasselbe Problem auf positive Weise unterstrichen“. „Der Mensch von heute hat ganz allgemein das Gefühl, dass Gott doch den größten Teil der Menschheit nicht verlorengehen lassen kann. In diesem Sinn ist die Sorge um das Heil, die für eine Zeit typisch war, größtenteils verlorengegangen“, äußerte Papst Benedikt.
Der Begriff der Barmherzigkeit als „Zeichen der Zeit“
Dennoch, so fährt der emeritierte Papst fort, spürten viele Christen auch weiterhin, „dass wir Gnade und Erlösung brauchen“. „Für mich ist die Tatsache, dass der Begriff von der Barmherzigkeit Gottes immer zentraler und dominanter wird, ein Zeichen der Zeit.“ Die Tendenz sei von der heiligen Faustina Kowalska ausgegangen und habe Papst Johannes Paul II. „zutiefst geprägt“. „Papst Franziskus liegt gänzlich auf dieser Linie. Seine pastorale Praxis drückt sich genau durch die Tatsache aus, dass er zu uns kontinuierlich über die Barmherzigkeit Gottes spricht. Es ist die Barmherzigkeit, die uns zu Gott hinbewegt, während seine Gerechtigkeit uns erschreckt. Meiner Meinung nach zeigt das, dass der Mensch von heute unter der Patina der Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit doch im Tiefsten um seine Wunden und seine Unwürdigkeit im Angesicht Gottes weiß.“
Er halte es daher für „keinen Zufall“, dass das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter „besonders anziehend für die Zeitgenossen“ sei, so der bald 89-jährige Papst Benedikt: Die Menschen von heute hofften offenbar im Innersten, „dass der Samariter ihnen zu Hilfe kommt, sich über sie beugt, Öl auf ihre Wunden gießt, sich um sie kümmert und in Sicherheit bringt“.
„Letztlich wissen sie, dass sie die Barmherzigkeit Gottes und sein Feingefühl brauchen. In der Härte der technisierten Welt, in der die Gefühle nichts mehr gelten, wächst doch die Erwartung einer rettenden Liebe, die vorbehaltlos gegeben wird. Mir scheint, dass sich im Thema der göttlichen Barmherzigkeit das, was die Rechtfertigung durch den Glauben bedeutet, auf neue Weise ausdrückt. Von der Barmherzigkeit Gottes ausgehend, die alle suchen, kann man auch heute den Kern der Rechtfertigungslehre neu interpretieren und ihn in seiner ganzen Relevanz darstellen.“
„Nur unbegrenzte Liebe kommt gegen das Böse an“
Im weiteren Fortgang des Gesprächs wird dann die Frage vertieft, in welcher Hinsicht der Tod Jesu am Kreuz eine Sühne für die Sünden der Menschen war. Es gelte, „auf neue Weise die Wahrheit hinter einer solchen Ausdrucksweise zu verstehen zu versuchen“, so der emeritierte Papst. „Von der Trinitätstheologie ausgehend“ sei es „vollkommen falsch“, einem vermeintlich „auf Gerechtigkeit bestehenden Vater“ einen „gehorsamen Sohn“ gegenüberzustellen, „der die grausame Forderung der Gerechtigkeit akzeptiert“. „Vater und Sohn sind eins, und darum ist auch ihr Wille intrinsisch ein einziger. Wenn der Sohn am Ölberg mit dem Willen des Vaters ringt, dann nicht, weil er eine grausame Verfügung Gottes akzeptieren müsste, sondern weil er die Menschheit ins Innere des Willens Gottes hineinziehen will.“
Die Antwort auf die Frage „Warum das Kreuz und die Sühne“ könne man, so fährt Benedikt XVI. fort, „heute auf neue Weise formulieren“. Das „unglaublich schmutzige Ausmaß des Bösen“ in der Welt lasse sich „nicht einmal durch Gott“ einfach für „nichtexistent erklären“, sondern müsse „gereinigt“ und „überwunden“ werden. Die frühen Christen hätten „gewusst, dass angesichts der Übermacht des Bösen nur eine unbegrenzte Liebe, eine unendliche Sühne Genüge tun kann“. „Sie wussten, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus eine Macht ist, die sich der des Bösen entgegenstellen und die Welt retten kann. Und auf dieser Basis konnten sie auch den Sinn des eigenen Leidens als in die leidende Liebe Christi hineingenommen verstehen, als Teil der erlösenden Kraft dieser Liebe.“
Zum Verhältnis von Vater und Sohn in Gott zitiert Benedikt den Theologen Henri de Lubac: Der Vater selbst sei „nicht leidenschaftslos“. „In einigen Teilen Deutschlands gab es eine sehr bewegende Verehrung, die die Not Gottes betrachtete. Mir führt das ein beeindruckendes Bild vor Augen, das den leidenden Vater zeigt, wie er als Vater innerlich die Leiden des Sohnes teilt. Und auch das Bild des „Gnadenstuhls“ gehört zu dieser Verehrung: Der Vater hält das Kreuz und den Gekreuzigten, beugt sich liebevoll über ihn und ist, gewissermaßen, mit ihm am Kreuz.“ Das lasse erkennen, das man nicht von einer „grausamen Gerechtigkeit“ oder gar einem „Fanatismus des Vaters“ sprechen könne.
Theorie vom „anonymen Christen“ greift zu kurz
Benedikt XVI. äußert sich in dem Gespräch auch zur Heilsnotwendigkeit Christi und der Kirche. Hier habe es „eine tiefe Entwicklung des Dogmas“ gegeben: Hätten noch „die großen Missionare des 16. Jahrhunderts“ geglaubt, Nichtgetaufte seien für immer verloren, so sei diese Überzeugung „nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil definitiv aufgegeben worden“. Daraus ergebe sich allerdings „eine tiefe, doppelte Krise“: „Zum einen scheint das jede Motivation für einen künftigen missionarischen Einsatz wegfallen zu lassen.“ Zum anderen sei „der obligatorische Charakter des Glaubens“ und der christlichen „Lebensform“ fraglich geworden.
Darauf habe zum Beispiel „die wohlbekannte These Karl Rahners von den anonymen Christen“ zu antworten versucht; in ihr „fällt das Christliche mit dem Menschlichen zusammen, und in diesem Sinn ist jeder Mensch, der sich selbst akzeptiert, Christ, auch wenn ihm das nicht bewusst ist“. Diese Theorie sei zwar „faszinierend“, aber sie vernachlässige „das Drama des Umkehrens und der Erneuerung, die im Christentum zentral ist“. Für „noch weniger akzeptabel“ erklärt der emeritierte Papst die Vorstellung, alle Religionen seien „jede auf ihre Weise“ Heilswege und könnten deswegen gewissermaßen für „gleichwertig“ gehalten werden. Diese Vorstellung werde „der Größe der Frage“ in keiner Weise gerecht.
Benedikt selbst hält sich in dieser Hinsicht eher an die Theologie de Lubacs, so wie er sie schon in seiner Zeit als Theologieprofessor etwa in seiner „Einführung in das Christentum“ ausgeführt hat. „Christus war und ist für alle, und die Christen, die in dem außerordentlichen Bild des Paulus in dieser Welt seinen Leib bilden, haben Anteil an diesem Sein-für. Man ist also Christ sozusagen nicht für sich selbst, sondern mit Christus für die anderen.“ Das löse zwar das angesprochene Problem nicht zur Gänze, „aber mir scheint das die wirklich wesentliche Intuition zu sein, dass dadurch die Existenz des einzelnen Christen berührt wird“. Es sei „für die Menschheit wichtig“, dass das „Sein-für“ geglaubt und praktiziert, dass dafür auch gelitten werde. „Diese Wirklichkeiten dringen mit ihrem Licht ins Innere der Welt als solcher und erhalten sie. Ich glaube, dass es für uns in der gegenwärtigen Lage immer deutlicher und verständlicher wird, was der Herr zu Abraham sagt – dass nämlich schon zehn Gerechte genügt hätten, um eine Stadt überleben zu lassen… Es ist aber klar, dass wir über die ganze Frage noch weiter nachdenken müssen.“
Stefan von Kempis übersetzte die wörtliche Rede in diesem Text aus dem Italienischen in eigener Übersetzung. (rv)
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...
 Radio Vatikan und KNA berichten heute:
Radio Vatikan und KNA berichten heute:

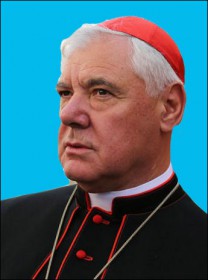 „Iuvenescit Ecclesia – die Kirche verjüngt sich“: So heißt ein Brief der Glaubenskongregation an die Bischöfe, der nächsten Dienstag im Vatikan vorgestellt wird. Thema ist das oft heikle Verhältnis kirchlicher Bewegungen und Gruppen zur Hierarchie. Dürfen Bewegungen schalten und walten, wie sie wollen, oder müssen sich an die Vorgaben des zuständigen Ortsbischofs halten? Das dürfte eine der Fragen sein, die das vom Papst schon im letzten März approbierte Papier behandelt.
„Iuvenescit Ecclesia – die Kirche verjüngt sich“: So heißt ein Brief der Glaubenskongregation an die Bischöfe, der nächsten Dienstag im Vatikan vorgestellt wird. Thema ist das oft heikle Verhältnis kirchlicher Bewegungen und Gruppen zur Hierarchie. Dürfen Bewegungen schalten und walten, wie sie wollen, oder müssen sich an die Vorgaben des zuständigen Ortsbischofs halten? Das dürfte eine der Fragen sein, die das vom Papst schon im letzten März approbierte Papier behandelt. Ein Interview des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat aufhorchen lassen. In einem Zitat, das am Mittwoch daraus bekannt wurde, würdigt Benedikt seinen Nachfolger Franziskus dafür, dass er die göttliche Barmherzigkeit zu einem Leitthema seines Pontifikats gemacht hat. Es ist die erste „öffentliche“ Äußerung des emeritierten über den amtierenden Papst.
Ein Interview des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat aufhorchen lassen. In einem Zitat, das am Mittwoch daraus bekannt wurde, würdigt Benedikt seinen Nachfolger Franziskus dafür, dass er die göttliche Barmherzigkeit zu einem Leitthema seines Pontifikats gemacht hat. Es ist die erste „öffentliche“ Äußerung des emeritierten über den amtierenden Papst. Die Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ würdigt den verstorbenen US-Internetpionier Raymond Tomlinson. Der Erfinder der E-Mail sowie des @-Zeichens verschied am Samstag im Alter von 74 Jahren. Im Jahre 1971 hatte er die erste E-Mail versandt, eine Entwicklung, die das Feld der Kommunikation revolutionieren sollte. Der „Osservatore“ würdigte Tomlinson als „demütigen und bescheidenen Mann, der selten E-Mails verschickte“. Der Vatikan selbst nutzt das Internet seit 1995. Im November 2001 verschickte erstmals ein Papst – der heilige Johannes Paul II. – eine E-Mail. (rv)
Die Vatikanzeitung „L’Osservatore Romano“ würdigt den verstorbenen US-Internetpionier Raymond Tomlinson. Der Erfinder der E-Mail sowie des @-Zeichens verschied am Samstag im Alter von 74 Jahren. Im Jahre 1971 hatte er die erste E-Mail versandt, eine Entwicklung, die das Feld der Kommunikation revolutionieren sollte. Der „Osservatore“ würdigte Tomlinson als „demütigen und bescheidenen Mann, der selten E-Mails verschickte“. Der Vatikan selbst nutzt das Internet seit 1995. Im November 2001 verschickte erstmals ein Papst – der heilige Johannes Paul II. – eine E-Mail. (rv) Kurienkardinal Kurt Koch hat ein mutigeres Eintreten aller Kirchen für verfolgte Christen in der Welt gefordert. „Ich glaube, wir schweigen zu viel“, sagte Koch, der am Heiligen Stuhl für die Ökumene verantwortlich ist, in einem Interview mit der Vatikanzeitung „L´Osservatore Romano“ von diesem Sonntag. Die „Ökumene des Leidens“, von der Papst Franziskus spreche, sei „das tiefste und geistlichste Fundament“ des gemeinsamen Eintretens der Kirchen gegen Christenverfolgung. Das gelte gerade für die Ursprungsländer des Christentums in Nahen Osten, „wo die Christen fliehen und in gezwungen werden, wegzugehen, weil sie ermordet werden, wenn sie bleiben“. Es sei „traurig zu sehen, wie nur die leeren Gebäude bleiben und nicht die Menschen“. In Syrien lasse sich aber auch beobachten, wie die Verfolgung die Christen vereine.
Kurienkardinal Kurt Koch hat ein mutigeres Eintreten aller Kirchen für verfolgte Christen in der Welt gefordert. „Ich glaube, wir schweigen zu viel“, sagte Koch, der am Heiligen Stuhl für die Ökumene verantwortlich ist, in einem Interview mit der Vatikanzeitung „L´Osservatore Romano“ von diesem Sonntag. Die „Ökumene des Leidens“, von der Papst Franziskus spreche, sei „das tiefste und geistlichste Fundament“ des gemeinsamen Eintretens der Kirchen gegen Christenverfolgung. Das gelte gerade für die Ursprungsländer des Christentums in Nahen Osten, „wo die Christen fliehen und in gezwungen werden, wegzugehen, weil sie ermordet werden, wenn sie bleiben“. Es sei „traurig zu sehen, wie nur die leeren Gebäude bleiben und nicht die Menschen“. In Syrien lasse sich aber auch beobachten, wie die Verfolgung die Christen vereine. „Eine Reform pro Monat“ verspricht der künftige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi. Der Jungstar von der „Demokratischen Partei“ verdrängte seinen Parteifreund Enrico Letta aus dem Amt des Regierungschefs; an diesem Montag hat er vom Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Doch von der italienischen Kirche kommen einige Renzi-kritische Töne.
„Eine Reform pro Monat“ verspricht der künftige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi. Der Jungstar von der „Demokratischen Partei“ verdrängte seinen Parteifreund Enrico Letta aus dem Amt des Regierungschefs; an diesem Montag hat er vom Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Doch von der italienischen Kirche kommen einige Renzi-kritische Töne.